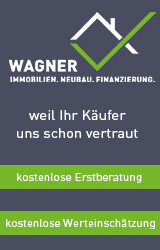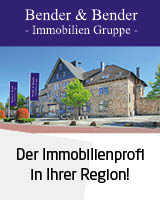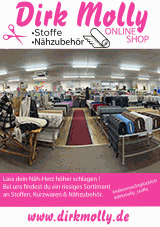Wachsende Wolfspopulation: Der große Streit um die Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht
 Von Thomas Sonnenschein
Von Thomas Sonnenschein
Die zunehmende Wolfspopulation führt zu Spannungen zwischen Befürwortern und Gegnern des besonderen Schutzstatus des Wolfs in Deutschland. Insbesondere die Naturschutzinitiative e.V. (NI) sieht keinen fachlichen Grund, warum der Wolf in das Jagdrecht aufgenommen werden sollte. Bürgerinitiativen im Westerwald sehen das ganz anders.

Westerwald. Am Freitagmorgen (7. Februar) hatte eine Spaziergängerin mit ihrem Hund auf einem ausgedehnten Weidengelände in einem Wissener Stadtteil, nur 200 Meter von Häusern entfernt, einen arg ramponierten Rehkadaver entdeckt. Sie verständigte umgehend den zuständigen Landwirt, der sie an den Jagdpächter weitervermittelte. Ein Foto des Rehs liegt der Redaktion vor. Wir ersparen unseren Lesern den Anblick.
Derartige Funde sind wichtig für das Erfassen der Ausbreitung und Anzahl der Wölfe im Westerwald. Das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (KLUWO) der Landesregierung lässt die Spuren nach genetischem Material vom Senckenberg-Institut untersuchen, um gezielt bestimmte Wölfe nachzuweisen.
Aktuelle Untersuchungen von Schadensfällen
Die Untersuchungen brauchen Zeit. Am 23. Januar wurde aus der Verbandsgemeinde Hachenburg ein Schadensfall mit zwei toten Stück Damwild und vier toten Schafen mit Verdacht auf Beteiligung eines großen Beutegreifers gemeldet. Eine Begutachtung vor Ort wurde noch am selben Tag durchgeführt. Bis heute kann die Beteiligung eines großen Beutegreifers weder bestätigt noch ausgeschlossen werden. Bei einem weiteren Schadensfall im Gemeindegebiet Buchholz (Verbandsgemeinde Asbach) vom 21. Januar hingegen wurde bei zwei toten Damhirschen ein Wolfsriss bestätigt, mit dem Haplotyp HW01 (Mitteleuropäischen Flachlandpopulation). Zudem wurde ein Haushund nachgewiesen. Möglicherweise machte sich dieser im Nachgang an dem erlegten Wild zu schaffen.
Weitere Verdachtsfälle mit totem Damwild liegen vom 10. Februar aus der Verbandsgemeinde Asbach um vom 13. Februar aus der Verbandsgemeinde Hachenburg vor. Ebenfalls am 13. Februar wurde eine tote Ziege in der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach entdeckt. Die Individualisierung der Proben ist jeweils in Bearbeitung.
Hilfreich für die Erfassung der Wolfspopulation sind auch deren Hinterlassenschaften. Durch genetische Analysen von Kotfunden konnten mehrere bis dato nicht genetisch erfasste Welpen bestehender Rudel festgestellt werden. Ein Welpe des Hachenburg-Rudels wurde dadurch erstmals bei Selters nachgewiesen. Die eher nüchterne Namensgebung lautet GW4431m, eine Verpaarung von GW2480f mit GW2478m. Ein weiterer Welpe des Leuscheid-Rudels wurde in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld festgestellt: GW4518m, eine Verpaarung von GW1999f mit dem Problemwolf GW1896m. Die Population wächst also.
Umgekehrt wurde am Mittwoch (19. Februar) in der Nähe von Rettersen (VG-Altenkirchen-Flammersfeld) ein Todfund eines mutmaßlichen Wolfs aus dem Rudelterritorium Leuscheid gemeldet. Es handelt sich augenscheinlich um ein bisher nicht bekanntes weibliches Jungtier, vermutlich Jahrgang 2024, mit rund 24 kg Gewicht. Die Todesursache ist derzeit nicht bekannt. Das Tier wird weiteren Untersuchungen zugeführt.
Bauernverband fordert Entnahme von Wölfen
Das Bundesumweltministerium zählt aktuell in Deutschland rund 1.600 Wölfe. Der Deutsche Bauernverband hält diese amtliche Erfassung für lückenhaft und geht von 2.500 Wölfen aus. Der Verband fordert schon lange schärfere Maßnahmen. Während in Frankreich jeder fünfte der 1.000 Wölfe dort jedes Jahr abgeschossen würde und Norwegen und Schweden zusammen der Wolfsbestand von derzeit 500 auf 300 Tiere verringert werden soll, würde im dicht besiedelten Deutschland gar nichts passieren, obwohl sich der Bestand an Wölfen immer noch weiter erhöht. Experten würden davon ausgehen, dass sich die Wolfsbestände alle fünf Jahre verdoppeln.
Naturschutzverbände sind alarmiert
Dennoch kritisiert der NABU Rheinland-Pfalz die geplante Aufnahme des Wolfs
ins rheinland-pfälzische Jagdrecht als symbolpolitischen Schnellschuss. "Wenn das Vertrauen in die Möglichkeit eines Abschusses dazu führt, dass noch häufiger auf geeignete Herdenschutzmaßnahmen verzichtet wird, kommt es zwangsläufig zu mehr Weidetierrissen", argumentiert Cosima Lindemann, Vorsitzende des NABU Rheinland-Pfalz. Die einzig weitgehend wirksame Maßnahme gegen Übergriffe auf Nutztiere sei ein ausreichender Herdenschutz.
Die Naturschutzinitiative (NI) geht noch weiter: "Geschütze Arten gehören prinzipiell nicht in das Jagdrecht. Wir werden daher, sollte der Wolf in das Jagdrecht aufgenommen werden, alle möglichen rechtlichen Schritte dagegen in die Wege leiten", konstatiert Gabriele Neumann, Projektleiterin Großkarnivoren der NI.
Auch Wissenschaftler stehen auf verschiedenen Seiten
"Wölfe gefährden nicht die Weidetierhaltung. Herdenschutz ist vielfach erprobt, gegenteilige Behauptungen der Nichtmachbarkeit sind falsch, es gibt immer Lösungen. Wer Tiere hält, muss diese nach dem Tierschutzgesetz auch vor Naturgefahren schützen, vor Blitz, Donner, Viren und Wolf", betont der Ökologe Dr. Michael Altmoos, wissenschaftlicher Beirat der NI.
Befürworter und Gegner der Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht organisieren regelmäßig Info-Abende, unterstützt jeweils von Experten aus der Wissenschaft, die ebenfalls auf verschiedenen Seiten stehen. So organisiert die Bürgerinitiative "Wolfsprävention Westerwald" zum Beispiel einen Fachvortrag mit Veterinärmediziner Dr. Michael Weiler am 7. März in Katzwinkel, um 19 Uhr, in der Glück-Auf-Halle.
Die Initiative sorgt sich zunehmend um die unregulierte und stetig steigende Ausbreitung der Wolfspopulation im Westerwald, die rückläufige Entwicklung des Wildtierbestandes und die Existenzgefährdung in der Landwirtschaft seien die direkte Folge. Unsicherheit und Angst der Bevölkerung um Weide- und Haustiere, spielende Kinder und auch erwachsene Spaziergänger in der Natur würden wachsen. Die Bürgerinitiative fordert deshalb entsprechende Änderungen des Bundesnaturschutzgesetzes und die Festlegung einer Obergrenze des Wolfsbestandes im Westerwald.
Naturschutzinitiative zeigt sich nicht kompromissbereit
Knallharte Anfeindungen hagelt es seitens der NI auf derartige Bürgerinitiativen: Wer wolffreie Dörfer fordere, habe sich nicht nur wildbiologisch völlig disqualifiziert, sondern betreibe Hetze gegen dieses Tier und fordere im Grunde dessen erneute Ausrottung.
Bianca Belleflamme, Mitbegründerin der Bürgerinitiative "Wolfsprävention Westerwald" kontert, es gehe keinesfalls um Ausrottung, sondern um sachlich fundierte Regulierung. Nach dem Vortrag am 7. März würde zudem eine Podiumsdiskussion stattfinden mit Gegnern und Befürwortern der Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht. Die Initiative wolle nicht polarisieren.
Gerichte befassen sich zunehmend mit dem Wolfs-Status
Auch die Absenkung des Schutzstatus des Wolfes von "stark geschützt" auf "geschützt" auf EU-Ebene bringt die Naturschützer auf die Palme. Mehr als 70 europäische Naturschutzverbände haben Klage beim Europäischen Gerichtshof (EUGH) eingereicht, mit dem Ziel, die Herabstufung des Wolfes für rechtswidrig zu erklären. Diese Klage wurde am 17. Februar vom EUGH angenommen.
Generell beschäftigen sich Gerichte immer wieder mit Problemwölfen. Der Wolfsrüde GW1896m aus dem Leuscheider Rudel, der bereits für etliche Risse verantwortlich gemacht werden konnte, darf von Jägern nicht entnommen werden. So entschied das Verwaltungsgericht Koblenz am 17. Dezember 2024. Ein Herdenschutz mit einer Zaunhöhe von 1,2 Metern sei als Alternative zur Entnahme des Wolfs anzusehen. Diese Zaunhöhe entspricht den derzeitigen Vorgaben, obwohl Herdentierhalter immer wieder berichten, dass selbst 1,8 Meter hohe Zäune von Wölfen überwunden werden können. Die erneute Überprüfung einer Entnahme darf aber laut Gericht erst angesetzt werden, wenn der Wolf GW1896m den empfohlenen Wolfs-abweisenden Herdenschutz mehrfach im zeitlichen und räumlichen engen Abstand überwindet.
Nur vier Tage später (21. Dezember 2024), wurde im Rahmen eines Schadensfalls mit 3 toten Schafen innerhalb des Gemeindegebiets Kescheid, (Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld) als Ergebnis "Wolf" mit dem Haplotyp HW01 nachgewiesen, obwohl ein den Vorgaben des Wolfs-abweisenden Grundschutzes entsprechender Herdenschutz vorhanden war. Das KLUWO steht bezüglich der Ausgleichszahlung mit den Tierhaltern in Kontakt.
Das KLUWO empfiehlt zur Vorbeugung des Überwindens von Weidenetzzäunen durch das nun mutmaßlich erlernte Springen des Wolfs-Individuums GW1896m, die Verwendung einer zusätzlichen optischen Barriere. Diese sollte durch die Verwendung zusätzlicher mobiler Weidezaunpfähle und daran befestigtem hellem zwei Zentimeter breitem Band oberhalb der Zaunoberkante des Weidenetzes verlaufen und maximal einen Abstand von 30 cm zur oberen Weidezaunkante aufweisen. Die Empfehlung gilt für die Verbandsgemeinden Altenkirchen-Flammersfeld, Hamm und Asbach.
Ein neuer, unbekannter Wolf taucht auf
Hinsichtlich des möglichen wiederholten Nachweises eines bisher unbekannten Wolfes in RLP aus der Alpen-/Italienischen-Population außerhalb der ausgewiesenen rheinland-pfälzischen Präventionsgebiete seit 2024 und der grundsätzlichen Möglichkeit einer Etablierung dieses einen Tieres im Land, weist das KLUWO auf die Wichtigkeit der Meldung von Wolfs-Hinweisen an die zentrale Großkarnivoren-Hotline des Landes hin (Telefon: 06306-199 199). Nur durch vom Land bestätigte, wiederholte Wolfs-Nachweise könnte gemäß des Managementplans Wolf RLP, neue Regionen als Präventionsgebiet ausgewiesen werden. (Thomas Sonnenschein)
 Unser Leser Markus Dübbert hat über seine Begegnung mit einem Wolf auf Facebook ein Video veröffentlicht.
Unser Leser Markus Dübbert hat über seine Begegnung mit einem Wolf auf Facebook ein Video veröffentlicht.
Mehr dazu:
Wolf
Feedback: Hinweise an die Redaktion