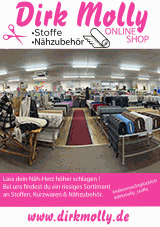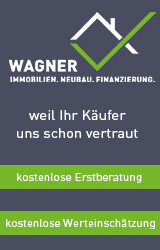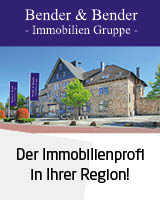Heizungsgesetz: Die häufigsten Irrtümer und Fakten erklärt
Kaum ein Gesetz sorgt in Deutschland für mehr Unsicherheit als das sogenannte „Heizungsgesetz“, offiziell Gebäudeenergiegesetz (GEG). Dieser Artikel klärt die häufigsten Missverständnisse und bietet klare Fakten.

Das Heizungsgesetz – Die häufigsten Irrtümer und Missverständnisse
Kaum ein Gesetz hat in den vergangenen Monaten für so viel Aufregung und Unsicherheit gesorgt wie das sogenannte „Heizungsgesetz“, offiziell als Gebäudeenergiegesetz (GEG) bekannt. In den Medien kursieren zahlreiche Schlagzeilen über angebliche Verbote, immense Kosten und drastische Sanierungspflichten. Viele Eigentümerinnen und Eigentümer fragen sich daher: Muss ich meine Heizung jetzt sofort austauschen? Drohen mir hohe Investitionen? Welche Alternativen gibt es überhaupt?
Ein wesentlicher Grund für diese Verunsicherung ist die teils widersprüchliche Berichterstattung. Während einige Quellen von drastischen Maßnahmen sprechen, betonen andere, dass es langfristige Übergangsfristen und umfassende Fördermöglichkeiten gibt. Nicht selten entstehen dadurch Missverständnisse, Halbwahrheiten oder schlichtweg falsche Annahmen, die zu unnötiger Besorgnis führen.
Dieser Artikel soll dazu beitragen, die häufigsten Irrtümer rund um das Heizungsgesetz aus der Welt zu schaffen. Statt unbegründete Ängste zu schüren, geht es darum, die Regelungen sachlich und verständlich einzuordnen. Denn wer gut informiert ist, kann fundierte Entscheidungen für die Zukunft treffen.
Die wichtigsten Regelungen des Heizungsgesetzes im Überblick
Um die häufigsten Missverständnisse aufzuklären, ist es zunächst wichtig, die grundlegenden Inhalte des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu verstehen. Das Gesetz verfolgt das Ziel, den Anteil erneuerbarer Energien in Heizsystemen zu erhöhen und langfristig den CO₂-Ausstoß im Gebäudesektor zu senken. Doch anders als oft behauptet, bedeutet dies keinen sofortigen Zwang zum Austausch bestehender Heizungen. Vielmehr gibt es klare Übergangsfristen und verschiedene Umsetzungswege, die Eigentümerinnen und Eigentümern Spielraum lassen.
Gilt das Gesetz für alle Gebäude gleichermaßen?
Nein. Die Regelungen unterscheiden sich je nach Gebäudeart und Baujahr:
• Neubauten in Neubaugebieten müssen bereits seit dem 1. Januar 2024 Heizsysteme einbauen, die mindestens 65 % erneuerbare Energien nutzen.
• Bestandsgebäude unterliegen keiner sofortigen Austauschpflicht. Bestehende Heizungen dürfen weiterbetrieben werden, solange sie funktionstüchtig sind.
• In Einzelfällen gibt es Härtefallregelungen, insbesondere für ältere Gebäude, bei denen ein Austausch unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen würde.
Was passiert mit bestehenden Öl- und Gasheizungen?
Eine der größten Befürchtungen ist, dass ab 2024 alle Öl- und Gasheizungen verboten werden. Das ist nicht korrekt.
• Bereits installierte Heizungen können bis zum Ende ihrer Lebensdauer weiter genutzt werden.
• Falls eine Heizung irreparabel defekt ist, dürfen neue Öl- oder Gasheizungen unter bestimmten Bedingungen weiterhin eingebaut werden. Allerdings müssen sie schrittweise auf erneuerbare Energien umgerüstet werden können.
Welche Heizsysteme sind zukünftig erlaubt?
Das Heizungsgesetz setzt nicht ausschließlich auf Wärmepumpen, wie häufig angenommen wird. Tatsächlich bleibt die Wahl des Heizsystems flexibel, solange es die Mindestanforderung von 65 % erneuerbaren Energien erfüllt.
Zu den möglichen Lösungen gehören:
• Wärmepumpen, die Wärme aus Luft, Wasser oder Erdwärme nutzen
• Hybridheizungen, die Gas- oder Ölheizungen mit erneuerbaren Energien kombinieren
• Anschluss an ein Wärmenetz, sofern in der Region vorhanden
• Pellet- oder Holzheizungen, unter Einhaltung der Emissionsgrenzwerte
• Solarthermie, als ergänzende Heiztechnik
Gibt es finanzielle Unterstützung?
Ja, der Staat bietet umfangreiche Fördermöglichkeiten, um die Umstellung auf erneuerbare Heizsysteme wirtschaftlich tragbar zu machen. Insbesondere die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) stellt verschiedene Programme zur Verfügung, die sowohl Zuschüsse als auch zinsgünstige Kredite umfassen.
KfW-Zuschussprogramm 458: Heizungsförderung für Privatpersonen – Wohngebäude
Dieses Programm richtet sich an Eigentümerinnen und Eigentümer von bestehenden Wohngebäuden in Deutschland und fördert den Kauf und die Installation klimafreundlicher Heizungen. Die wichtigsten Eckpunkte sind:
• Förderfähige Maßnahmen:
o Solarthermische Anlagen: Nutzung von Sonnenenergie zur Wärmegewinnung.
o Biomasseheizungen: Heizungen, die mit Holzpellets oder Hackschnitzeln betrieben werden.
o Elektrisch angetriebene Wärmepumpen: Systeme, die Umweltwärme aus Luft, Wasser oder Erde nutzen.
o Brennstoffzellenheizungen: Effiziente Strom- und Wärmeerzeugung durch chemische Prozesse.
o Wasserstofffähige Heizungen: Gas-Brennwertheizungen, die auf 100 % Wasserstoff umrüstbar sind.
o Innovative Heiztechnik auf Basis erneuerbarer Energien: Neue Technologien, die erneuerbare Energien nutzen.
o Anschluss an ein Gebäude- oder Wärmenetz: Integration in bestehende Wärmenetze.
• Förderhöhe:
o Grundförderung: 30 % der förderfähigen Kosten.
o Zusätzliche Boni:
Effizienzbonus: 5 % für besonders effiziente Wärmepumpen oder Biomasseheizungen mit niedrigen Emissionswerten.
Klimabonus: Bis zu 20 %, wenn die alte fossile Heizung frühzeitig ausgetauscht wird.
Einkommensabhängiger Bonus: 30 % für Haushalte mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von maximal 40.000 €.
Insgesamt kann die Förderung somit bis zu 70 % der förderfähigen Kosten betragen.
Mehr zur KfW Förderung 458
KfW-Ergänzungskredit 358, 359: Einzelmaßnahmen Ergänzungskredit – Wohngebäude
Für bereits bezuschusste Einzelmaßnahmen zur energetischen Sanierung von Wohngebäuden bietet die KfW einen Ergänzungskredit an:
• Kreditbetrag: Bis zu 120.000 € je Wohneinheit.
• Voraussetzung: Eine bereits erteilte Zuschussförderung muss vorliegen.
• Vorteil: Ermöglicht die Finanzierung der Restkosten zu günstigen Konditionen.
Mehr zur KfW Förderung 358 und 359
Antragsverfahren
Wichtig ist, dass vor der Antragstellung ein Lieferungs- oder Leistungsvertrag mit einem Fachunternehmen abgeschlossen wird. Dieser Vertrag muss eine aufschiebende oder auflösende Bedingung zur Zusage der Förderung enthalten. Das bedeutet, dass der Vertrag nur wirksam wird, wenn die Förderung bewilligt wird. Es ist ratsam, sich frühzeitig über die aktuellen Förderbedingungen zu informieren und gegebenenfalls eine Energieberatung in Anspruch zu nehmen, um die optimale Förderung für das individuelle Vorhaben zu erhalten.
Die häufigsten Irrtümer und ihre Aufklärung
Trotz der klar definierten Regelungen des Heizungsgesetzes halten sich viele Missverständnisse hartnäckig. Oft sind sie das Ergebnis von Halbwissen, emotional aufgeladenen Diskussionen oder verkürzten Medienberichten. Nachfolgend werden die häufigsten Irrtümer beleuchtet und durch sachliche Fakten korrigiert.
Irrtum 1: "Jede alte Heizung muss sofort ausgetauscht werden"
❌ Falsch: Ein weit verbreiteter Irrglaube ist, dass sämtliche alten Gas- und Ölheizungen ab 2024 nicht mehr betrieben werden dürfen und Hausbesitzer sofort eine neue Heizung einbauen müssen. Viele Eigentümer fürchten hohe, kurzfristige Kosten und eine Zwangssanierung.
✅ Richtig: Das Heizungsgesetz sieht keine generelle Austauschpflicht für bestehende Heizungen vor. Wer bereits eine funktionierende Öl- oder Gasheizung besitzt, darf diese weiterhin nutzen, bis sie irreparabel defekt ist.
Allerdings gibt es einige Ausnahmen und Fristen:
• Heizkessel, die älter als 30 Jahre sind, müssen ausgetauscht werden – das betrifft allerdings nur Konstanttemperaturkessel, die vor dem Jahr 1996 eingebaut wurden. Brennwert- und Niedertemperaturkessel sind von dieser Regelung nicht betroffen.
• Sollte eine bestehende Heizung ausfallen und nicht mehr reparabel sein, gibt es Übergangsfristen, in denen eine neue Heizung eingebaut werden muss.
Besonders wichtig ist: Selbst nach 2024 dürfen neue Öl- und Gasheizungen unter bestimmten Bedingungen weiterhin eingebaut werden. Hier greift ein gestuftes System, das sich nach dem Vorhandensein einer kommunalen Wärmeplanung richtet:
• In Städten und Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern müssen bis spätestens 2026 verbindliche Wärmepläne erstellt werden. Bis dahin ist der Einbau neuer Öl- und Gasheizungen weiterhin erlaubt.
• In kleineren Kommunen unter 100.000 Einwohnern gilt diese Frist bis 2028. Das bedeutet, dass bis dahin noch klassische Öl- und Gasheizungen eingebaut werden können.
• Sobald eine kommunale Wärmeplanung vorliegt, müssen neue Heizungen dann mindestens 65 % erneuerbare Energien nutzen.
In Regionen, in denen kein Fernwärmenetz vorhanden ist und erneuerbare Heizsysteme nur schwer umsetzbar sind, sind außerdem technische Ausnahmen möglich.
💡 Fazit: Bestehende Heizungen dürfen weiter genutzt werden, und auch nach 2024 sind neue Öl- und Gasheizungen unter bestimmten Bedingungen weiterhin erlaubt. Eigentümer müssen also keine übereilten Entscheidungen treffen.
Irrtum 2: "Gas- und Ölheizungen sind ab 2024 komplett verboten"
❌ Falsch: Viele Medienberichte haben den Eindruck erweckt, dass ab 2024 keine neuen Öl- oder Gasheizungen mehr eingebaut werden dürfen und Eigentümer gezwungen sind, auf Wärmepumpen oder andere erneuerbare Heizsysteme umzusteigen. Das ist jedoch nicht korrekt.
✅ Richtig: Ein komplettes Verbot von Gas- und Ölheizungen gibt es nicht. Die Nutzung bestehender Heizungen bleibt erlaubt, und unter bestimmten Voraussetzungen können auch weiterhin neue Öl- oder Gasheizungen eingebaut werden.
Welche Regelungen gelten für neue Heizungen?
• Bis 2026 (in Großstädten) bzw. 2028 (in kleineren Kommunen) dürfen weiterhin neue Gas- oder Ölheizungen eingebaut werden, da in dieser Zeit noch keine verpflichtende kommunale Wärmeleitplanung vorliegt.
• Auch nach 2026 bzw. 2028 ist ein Neueinbau möglich, wenn die neue Gas- oder Ölheizung auf eine Hybridlösung ausgelegt ist – also mit mindestens 65 % erneuerbaren Energien betrieben werden kann. Dazu gehören beispielsweise:
o Kombination mit einer Solarthermie-Anlage, die einen Teil des Heizbedarfs abdeckt.
o Nutzung von Biomethan oder künftig Wasserstoff-fähige Heizungen.
o Einbindung in ein Hybrid-Heizsystem mit Wärmepumpe oder Pelletheizung.
Gibt es Härtefallregelungen?
Ja. Falls eine Umrüstung auf ein erneuerbares Heizsystem unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen würde, kann es Ausnahmen für Eigentümer geben. Das gilt insbesondere für:
• Technische Unmöglichkeit, z. B. wenn eine Wärmepumpe aufgrund der Gebäudestruktur nicht wirtschaftlich oder technisch machbar ist.
• Unverhältnismäßige finanzielle Belastung, insbesondere für Eigentümer mit niedrigen Einkommen. Hier greift eine Einzelfallprüfung.
💡 Fazit:
• Gas- und Ölheizungen sind nicht generell verboten, sondern können unter bestimmten Bedingungen weiterhin installiert werden.
• Bis spätestens 2026 bzw. 2028 gibt es keine Einschränkungen für neue Öl- und Gasheizungen.
• Nach diesen Fristen sind Gasheizungen weiterhin erlaubt, wenn sie mit erneuerbaren Energien kombiniert werden.
Irrtum 3: "Das Gesetz zwingt jeden Haushalt zur Wärmepumpe"
❌ Falsch: Ein häufiges Missverständnis besteht darin, dass das Heizungsgesetz ausschließlich Wärmepumpen als neue Heizlösung vorsieht. Viele Eigentümer befürchten, dass sie keine Alternative haben und hohe Kosten für eine Wärmepumpe tragen müssen – auch wenn diese für ihr Gebäude nicht geeignet ist.
✅ Richtig: Es gibt keine gesetzliche Verpflichtung zur Wärmepumpe. Das Gesetz schreibt lediglich vor, dass neue Heizungen ab 2024 mindestens 65 % erneuerbare Energien nutzen müssen. Dies kann jedoch auf verschiedene Weise umgesetzt werden. Neben Wärmepumpen gibt es folgende Alternativen:
• Hybridheizungen: Kombination aus fossilen Brennstoffen und erneuerbaren Energien (z. B. Gasheizung mit Solarthermie oder Wärmepumpe).
• Pellet- und Holzheizungen: Biomasseheizungen, die Holzpellets, Hackschnitzel oder Stückholz nutzen.
• Anschluss an ein Wärmenetz: Falls verfügbar, kann ein Anschluss an ein Nah- oder Fernwärmenetz erfolgen.
• Solarthermie: Unterstützung durch Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung.
• Brennstoffzellenheizungen: Diese nutzen Wasserstoff zur effizienten Wärme- und Stromproduktion.
• Gasheizungen mit Biomethan oder Wasserstoffperspektive: Unter bestimmten Bedingungen können neue Gasheizungen installiert werden, wenn sie auf eine spätere Nutzung von erneuerbaren Gasen ausgelegt sind.
Eine Wärmepumpe kann eine sinnvolle Lösung sein, ist jedoch nicht für jedes Gebäude optimal. Besonders bei Altbauten mit unzureichender Dämmung oder ohne Fußbodenheizung kann eine Hybridlösung oder eine andere erneuerbare Heizform wirtschaftlicher sein.
💡 Fazit: Das Gesetz bietet technologische Wahlfreiheit. Niemand wird zur Wärmepumpe gezwungen – vielmehr gibt es eine Vielzahl an Lösungen, die je nach Gebäudetyp und individueller Situation in Betracht kommen.
Irrtum 4: "Niemand kann sich die Umrüstung leisten"
❌ Falsch: Immer wieder wird behauptet, dass die Umstellung auf eine klimafreundliche Heizung für Eigentümer unerschwinglich ist und viele Hausbesitzer überfordert.
✅ Richtig: Die Bundesregierung hat umfangreiche Förderprogramme aufgelegt, um die Umstellung finanziell tragbar zu machen. Die tatsächlichen Kosten für Eigentümer hängen stark davon ab, ob sie die verfügbaren Förderungen in Anspruch nehmen.
Welche Förderungen gibt es?
• 30 % Grundförderung für alle klimafreundlichen Heizungen.
• Zusätzliche Boni:
o 20 % Klimabonus für den frühzeitigen Austausch fossiler Heizungen.
o 30 % einkommensabhängige Förderung für Haushalte mit einem zu versteuernden Einkommen unter 40.000 € pro Jahr.
• Kombination mit KfW-Krediten:
o Ergänzungskredit für Einzelmaßnahmen (bis zu 120.000 € je Wohneinheit).
o Zinsgünstige Kredite für Sanierungen mit einem Tilgungszuschuss.
Ein Beispiel: Eine neue Wärmepumpe kostet inklusive Installation ca. 25.000 €.
• Nach Abzug der 30 % Grundförderung bleibt eine Restsumme von 17.500 €.
• Wenn der Klimabonus von 20 % dazukommt, sinkt der Eigenanteil auf 12.500 €.
• Bei Anspruch auf die einkommensabhängige Förderung kann der Eigenanteil weiter auf 7.500 € reduziert werden.
Zusätzlich können günstige Kredite genutzt werden, sodass die monatliche Belastung überschaubar bleibt. Viele Eigentümer profitieren zudem langfristig von geringeren Heizkosten durch effizientere Systeme.
💡 Fazit: Die Umstellung auf erneuerbare Heizungen wird stark gefördert, sodass die finanzielle Belastung für Eigentümer deutlich niedriger ausfällt als oft angenommen. Es lohnt sich, Fördermöglichkeiten frühzeitig zu prüfen und sich individuell beraten zu lassen.
Irrtum 5: "Mieter müssen jetzt mit drastischen Mietsteigerungen rechnen"
❌ Falsch: Mieter befürchten, dass Vermieter die gesamten Modernisierungskosten auf sie umlegen und dadurch drastische Mietsteigerungen entstehen.
✅ Richtig: Das Gesetz enthält klare Regeln zur Begrenzung der Mietumlage, sodass Modernisierungskosten nicht unbegrenzt auf die Miete übertragen werden können.
Welche Regeln gelten für Mieterhöhungen?
• Vermieter dürfen höchstens 8 % der Modernisierungskosten pro Jahr auf die Miete umlegen.
• Staatliche Förderungen müssen von den Modernisierungskosten abgezogen werden, bevor die Umlage berechnet wird.
• Falls die Heizkosten durch die neue Heizung sinken, kann die Gesamtkostenbelastung für Mieter sogar gleichbleiben oder sich verbessern.
Beispielrechnung für eine Mieterhöhung
Angenommen, die Modernisierungskosten betragen nach Abzug der Förderung 10.000 € für eine Mietwohnung.
• Davon dürfen 8 % pro Jahr umgelegt werden: 800 € jährlich oder ca. 67 € monatlich.
• Liegt die Wohnung bei 80 m², würde sich die Miete um maximal 84 Cent pro Quadratmeter erhöhen.
• Falls die neuen Heizkosten um 20 bis 40 € monatlich sinken, bleibt die tatsächliche Mehrbelastung für den Mieter gering oder sogar neutral.
💡 Fazit: Das Heizungsgesetz führt nicht automatisch zu drastischen Mietsteigerungen. Vermieter müssen Förderungen berücksichtigen, und die Umlage ist gesetzlich begrenzt. In vielen Fällen profitieren Mieter sogar von niedrigeren Heizkosten.
Fazit: Klarheit schaffen und die richtigen Entscheidungen treffen
Viele Ängste rund um das Heizungsgesetz beruhen auf unzutreffenden Annahmen oder verkürzten Darstellungen. Die wichtigsten Fakten lauten:
✔️ Keine generelle Austauschpflicht für bestehende Heizungen.
✔️ Gas- und Ölheizungen bleiben unter bestimmten Bedingungen erlaubt.
✔️ Es gibt verschiedene Heizungsoptionen, nicht nur Wärmepumpen.
✔️ Hohe Förderungen machen den Umstieg finanziell tragbar.
✔️ Mieter sind durch gesetzliche Regelungen geschützt.
Wer sich frühzeitig mit den eigenen Möglichkeiten auseinandersetzt, kann von den Förderprogrammen profitieren und langfristig eine nachhaltige Lösung für die eigene Immobilie finden.
Weiterführende Informationen – Was Eigentümer jetzt tun können
Das Heizungsgesetz betrifft Millionen von Immobilienbesitzern in Deutschland. Auch wenn viele Befürchtungen unbegründet sind, bleibt es für Eigentümer wichtig, sich mit den neuen Regelungen auseinanderzusetzen. Je nach Gebäudeart, Standort und individuellen finanziellen Möglichkeiten gibt es unterschiedliche Wege, die neuen Anforderungen umzusetzen.
Welche Fragen sollten Eigentümer jetzt klären?
Wer sich mit dem Thema Heizungstausch befasst, sollte sich frühzeitig Gedanken über folgende Punkte machen:
• Welche Heizlösung passt zu meiner Immobilie?
o Ist eine Wärmepumpe möglich oder wäre eine Hybridlösung besser?
o Gibt es eine Möglichkeit, an ein Nah- oder Fernwärmenetz angeschlossen zu werden?
o Lohnt sich der Einbau einer Solarthermie- oder Biomasseheizung?
• Welche Übergangsfristen gelten für mein Gebäude?
o Habe ich eine funktionierende Heizung, die noch lange genutzt werden kann?
o Bis wann muss ich mich mit einem möglichen Austausch befassen?
• Welche Förderungen kann ich nutzen?
o Habe ich Anspruch auf einkommensabhängige Förderungen?
o Wie viel Zuschuss kann ich durch die KfW oder die BAFA erhalten?
o Kommt für mich ein zinsgünstiger Ergänzungskredit infrage?
Wo kann ich mich neutral informieren?
Es gibt zahlreiche offizielle Stellen, die umfassende und aktuelle Informationen zu den neuen Vorgaben, technischen Möglichkeiten und Förderprogrammen bereitstellen:
• KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau): Übersicht über Förderkredite und Zuschüsse für klimafreundliche Heizsysteme. (www.kfw.de)
• Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA): Informationen zu Förderprogrammen für erneuerbare Energien. (www.bafa.de)
• Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK): Detaillierte Erläuterungen zum Gebäudeenergiegesetz. (www.bmwk.de)
• Verbraucherzentrale Energieberatung: Kostenlose Beratung zu Heiztechnologien und Einsparpotenzialen. (www.verbraucherzentrale-energieberatung.de)
• Kommunale Wärmeplanung: Viele Städte und Gemeinden veröffentlichen Informationen darüber, ob und wann ein Anschluss an ein Wärmenetz geplant ist. Diese Informationen finden Sie meist auf den Webseiten der lokalen Stadtwerke oder der Kommune.
Individuelle Beratung kann sich lohnen
Da jede Immobilie andere Voraussetzungen hat, ist es oft sinnvoll, sich individuell beraten zu lassen. Besonders bei komplexen Fragen, wie etwa der Kombination verschiedener Heiztechnologien oder der Einschätzung des Modernisierungsbedarfs einer Immobilie, kann eine professionelle Einschätzung weiterhelfen. Auch ein Immobilienmakler in Neuwied kann Ihnen eine erste Einschätzung zu Ihrer persönlichen Heizungssituation geben und Sie beraten.
Eine frühzeitige Auseinandersetzung mit dem Thema kann nicht nur langfristig Kosten sparen, sondern auch sicherstellen, dass Eigentümer von den besten Förderprogrammen profitieren. Wer sich informiert, kann vorausschauend handeln und die beste Entscheidung für seine Immobilie treffen. (prm)
Mehr dazu:
Wirtschaft
Lokales: Neuwied & Umgebung
Feedback: Hinweise an die Redaktion